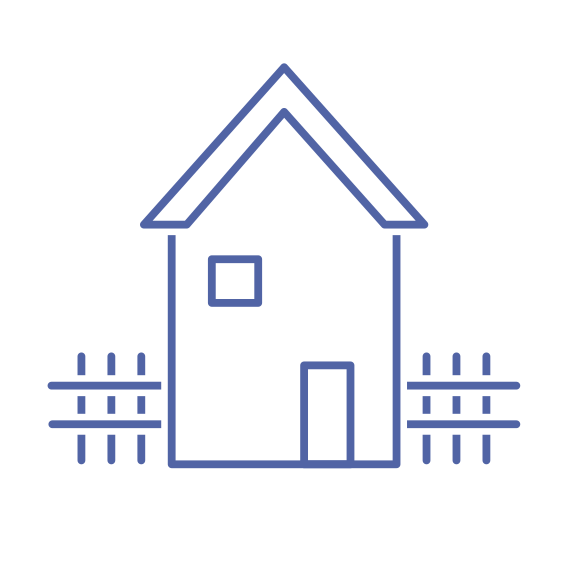Provinzial-Vorständin: „Als Versicherer sind wir gegen die Einführung einer Pflichtversicherung“
Wie gehen Wohngebäudeversicherer mit der wachsenden Belastung durch Extremwetter, Inflation und neue Vorschriften um? Sabine Krummenerl, Vorständin Komposit, Rückversicherung & Maklervertrieb der Provinzial, erklärt im Interview mit Versicherungsbote, warum eine kurzfristige Entspannung nicht in Sicht ist – und wie ihr Haus mit Opt-out-Modellen, individueller Risikoprüfung und technischen Präventionslösungen reagiert.

- Provinzial-Vorständin: „Als Versicherer sind wir gegen die Einführung einer Pflichtversicherung“
- „Folgekosten des Klimawandels können nicht einseitig auf Versicherer und ihre Versicherten verlagert werden“
Anzeige
Versicherungsbote: Sie sind einer der Marktführer in der Wohngebäudeversicherung. Die Branche steht unter immensem Druck: steigende Baukosten, Inflation, Extremwetter und hohe Schadenquoten belasten die Branche. Wie bewerten Sie die aktuelle wirtschaftliche Situation der Wohngebäudeversicherer – und ist eine Entspannung in Sicht?
Sabine Krummenerl: Die wirtschaftliche Situation der Wohngebäudeversicherer ist weiterhin herausfordernd. Gründe dafür sind stetig steigende Baupreise, die hohe Inflation, der Klimawandel und neue gesetzliche Vorgaben (z.B. die Gefahrstoffverordnung). Umso wichtiger ist es, über eine risikogerechte Beitragsgestaltung zukunftssicher aufgestellt zu sein, da eine kurzfristige Entspannung nicht in Sicht ist.
Welche Faktoren werden die Schadenbilanz in den kommenden Jahren am stärksten beeinflussen? Und wie gut ist die Branche aus Ihrer Sicht darauf vorbereitet?
Die größte Herausforderung sind die Extremwetterereignisse aufgrund des Klimawandels. Zudem sind die immer älter werdenden Gebäude besonders für Leitungswasserschäden anfällig. Wir rechnen hier mit einer Zunahme der Schadenfälle und- durchschnitte. Für uns als Gebäudeversicherer bedeutet dies, dass wir uns den Herausforderungen stellen und die aktuellen Entwicklungen im Blick behalten müssen. Hierzu gehören eine zeitgerechte Anpassung des Versicherungsschutzes, aber auch die Ausarbeitung von präventiven Maßnahmen.
Die Ahrtal-Katastrophe 2021 hat die Wohngebäudeversicherer massiv belastet. Welche spezifischen Herausforderungen ergaben sich daraus für Ihr Unternehmen, insbesondere in der Schadenregulierung und finanziellen Steuerung? Und haben sich daraus konkrete Anpassungen in Ihren Produkten oder im Risikomanagement ergeben?
Die Ahrtal-Katastrophe 2021 war für uns als größter Gebäudeversicherer in der Region eine besondere Herausforderung. Wir haben vor diesem Hintergrund ein neues Produktangebot für Elementargefahren zur Verfügung gestellt. Als Versicherer, der tief in seinen Regionen verwurzelt ist und eine besondere Nähe zu seinen Kundinnen und Kunden pflegt, prüfen wir im Rahmen des Risikomanagements jede Anfrage.
In den meisten Fällen können wir unseren Kundinnen und Kunden ein individuelles Angebot zur Wohngebäudeversicherung und in diesem Zug auch gegen Elementarschäden unterbreiten. Dies erfolgt bei 98 Prozent der Angebote automatisiert – und seit kurzem konzernweit über eine Opt-Out-Auswahl, sodass der Elementarschutz immer direkt mit der Wohngebäudeversicherung angeboten wird, sofern es die Kundin oder der Kunde nicht aktiv abwählt.
Auch in den sehr seltenen Fällen, bei denen ein Versicherungsschutz aufgrund der Risikosituation zunächst schwierig erscheint (z.B. ZÜRS-Zone 4), können wir oftmals eine Lösung finden – beispielsweise gegen höhere Selbstbehalte, Mehrbeitrag oder geforderte baulichen Maßnahmen. Dies erfolgt auf Basis unserer sehr individuellen Analyse und/oder einer Prüfung durch Expertinnen und Experten vor Ort.
Gibt es aus Ihrer Sicht Regionen in Deutschland, die heute ein ähnlich hohes Risiko wie das Ahrtal haben? Welche Maßnahmen können Versicherer und Kunden ergreifen, um sich besser gegen Extremwetter zu wappnen?
Es gibt viele Regionen in Deutschland, die betroffen sein können. Die topografischen Gegebenheiten finden sich auch andernorts. Hierzu ist oft nicht mal zwingend ein fließendes Gewässer in der Nähe erforderlich. Starkregen kann grundsätzlich überall auftreten.
Wir sehen aber nicht nur die Versicherer in der Pflicht, sondern auch die Länder und Kommunen, indem sie überschwemmungsgefährdete Gebiete nicht als Bauland ausweisen und notwendige Schutz- und Präventionsmaßnahmen umsetzen. Insbesondere bei der Katastrophe im Ahrtal haben wir alle gesehen, dass es nicht nur um den Schutz von Sachwerten, sondern auch um Menschenleben geht, die durch solche Ereignisse bedroht sind.
Als Versicherer können wir mit einer risikogerechten Annahme und einer bedarfsgerechten Beratung des Kunden unterstützen. Unsere Kunden können sich wappnen, indem sie ihr Gebäude auch durch bauliche Maßnahmen, wie Rückstauklappen, Sicherung von Kellerfenstern etc. schützen.
Welche Rolle spielen steigende Bau- und Lohnkosten für die Wohngebäudeversicherung? Und erwarten Sie hier eine Entspannung?
Steigende Bau- und Lohnkosten haben direkten Einfluss auf die Kosten einer Schadenregulierung. In den letzten Jahren sind die durchschnittlichen Schadenhöhen aufgrund dieser Entwicklungen überproportional gestiegen, wobei hier inflationsbedingt auch für die Zukunft keine schnelle Entspannung zu erwarten ist. Neue Vorschriften (z.B. die Gefahrstoffverordnung etc.) verstärken diesen Trend.
Die Rückversicherer verlangen zunehmend höhere Prämien für Naturkatastrophen-Deckungen. Wie stark belasten diese Kosten die Provinzial? Und welche strategischen Anpassungen haben Sie vorgenommen, um wirtschaftlich stabil zu bleiben?
Anzeige
Gestiegene Kosten für eine Rückversicherung können nicht unmittelbar an Kundinnen und Kunden weitergegeben werden. Das führt zu einer stärkeren Kostenbelastung, die erst einmal den Versicherer selbst betrifft. Mittel- und langfristig ist eine Berücksichtigung dieser volatilen Rückversicherungskosten in den Kalkulationen der einzelnen Produkte zu berücksichtigen, um wirtschaftlich stabil zu bleiben. Zukünftig werden nur die Versicherer die Wohngebäude-Versicherung weiter erfolgreich betreiben können, die über die notwendigen Eigenmittel verfügen.
„Folgekosten des Klimawandels können nicht einseitig auf Versicherer und ihre Versicherten verlagert werden“
Der Anpassungsfaktor für die Wohngebäudeversicherung lag 2023 auf einem historischen Höchststand von 14,7 Prozent und wurde für 2024 auf 7,5 Prozent gesenkt. Sind diese Anpassungen ausreichend, um die steigenden Schadenkosten aufzufangen? Oder stehen weitere Prämienerhöhungen bevor?
Wie schon ausgeführt, sorgen steigende Baupreise und Lohnkosten für eine stetige Zunahme der Schadenaufwände. Aber auch heute noch unbekannte mögliche gesetzliche Änderungen haben hierauf einen starken Einfluss. Vor diesem Hintergrund kann derzeit noch nicht beurteilt werden, ob und in welcher Höhe in naher Zukunft weitere höhere Anpassungen, insbesondere durch den Anpassungsfaktor, erforderlich sind. Wir gehen aber davon aus, dass der Faktor in den nächsten Jahren weiter steigen wird.
Anzeige
Welche Präventionsmaßnahmen können die Schaden-Kosten-Bilanz nachhaltig verbessern? Gibt es bereits konkrete Projekte der Provinzial, um durch Prävention langfristig Kosten zu senken?
Hier sehen wir Kundinnen und Kunden auch aus Eigenschutz in der Verpflichtung, ihr Objekt in einem ordnungsgemäßen und wetterfesten Zustand zu halten. Eigentümer sollten dafür sorgen, dass das Leitungswassersystem des Gebäudes funktioniert und gepflegt wird und dass Rückstauklappen vorhanden sind.
Für Versicherer ist eine risikogerechte Annahmeprüfung und Kalkulation wichtig. Wir arbeiten laufend an Präventionsmaßnahmen, die wir zusammen mit unseren Kundinnen und Kunden zur Schadenabwendung und Schadenminderung ergreifen können. Hierzu gehören zum Beispiel Leckagemelder und SmartHome-Systeme
Die Forderung nach einer Pflichtversicherung für Elementarschäden wird immer wieder diskutiert. Wie steht die Provinzial dazu? Und würde eine solche Lösung die Risiken in der Branche fairer verteilen – oder sehen Sie Alternativen?
Als Versicherer sind wir gegen die Einführung einer Pflichtversicherung, die die Versicherer sowie Kundinnen und Kunden einseitig belastet. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat deshalb sehr frühzeitig den Dreiklang aus Versicherungsschutz, Prävention und Stopp-Loss definiert. Als Provinzial unterstützen wir dieses Vorgehen ausdrücklich. Die Folgekosten durch den Klimawandel können nicht einseitig auf die Versicherer und ihre Versicherten verlagert werden.
Welche konkreten Maßnahmen erwarten Sie von der Politik, um die Situation der Wohngebäudeversicherer zu verbessern? Sind z. B. staatlich unterstützte Rückversicherungen oder steuerliche Entlastungen denkbare Lösungen?
Als Versicherer erwarten wir von der Politik bei neuen gesetzlichen Änderungen, wie zum Beispiel bei der Solarpflicht oder der Gefahrstoffverordnung, ein Konzept zur Integration in den Markt sowie finanzielle oder steuerliche Unterstützung bei derartigen Herausforderungen. Zudem erwarten wir insbesondere bei der Elementarabsicherung ganzheitliche Konzepte für die Prävention z.B. durch Bebauungspläne und Überschwemmungsschutz.
Anzeige
Sollte die Politik eine Pflichtversicherung zur Absicherung der Elementarschäden aller privaten Wohngebäude – unabhängig vom Überschwemmungsrisiko – beschließen, muss zwingend eine Lösung für große Katastrophen gefunden werden. Ansonsten drohen diese Ereignisse einzelne Versicherer finanziell zu überfordern. Eine staatliche unterstützte Rückversicherung kann dafür einer von mehreren Lösungswegen sein.
- Provinzial-Vorständin: „Als Versicherer sind wir gegen die Einführung einer Pflichtversicherung“
- „Folgekosten des Klimawandels können nicht einseitig auf Versicherer und ihre Versicherten verlagert werden“