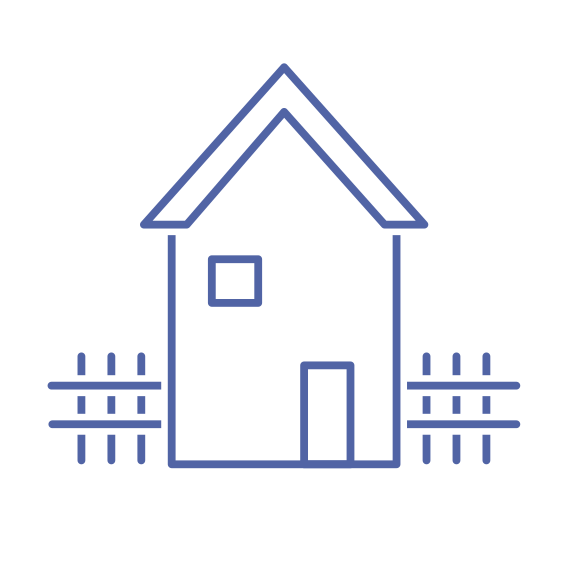SV SparkassenVersicherung-Vorstand: „Ohne Prävention wird bezahlbarer Schutz kaum möglich sein“
Steigende Baukosten, Extremwetter, neue Bauvorgaben: Die Wohngebäudeversicherung steht unter Druck – und eine Entspannung ist nicht in Sicht. Ralph Eisenhauer, Vorstandsmitglied Schaden/Unfall der SV SparkassenVersicherung, erklärt im Interview, warum die Belastungen struktureller Natur sind, welche Rolle Rückversicherung und Prävention spielen – und wie die SV ihre Tarife an neue Risiken anpasst.

- SV SparkassenVersicherung-Vorstand: „Ohne Prävention wird bezahlbarer Schutz kaum möglich sein“
- „Eine Pflichtversicherung in Reinform würde zu kurz greifen“
Versicherungsbote: Die Wohngebäudeversicherung steht unter Druck: steigende Baukosten, Inflation, Extremwetter und hohe Schadenquoten belasten viele Versicherer. Wie bewerten Sie die aktuelle Lage der Branche?
Anzeige
Ralph Eisenhauer: In der Tat steht die Branche unter Druck. In den vergangenen drei Jahren hat die Branche im Durchschnitt für 100 EUR eingenommene Prämie rund 102 EUR für Kosten und Schäden aufbringen müssen. Die Branche hat also Verluste gemacht. Dies ist umso bemerkenswerter, da in diesen drei Jahren keine ganz außergewöhnlichen Schadenereignisse zu verzeichnen waren. Wie ist nun der Blick nach vorne? Ich gehe davon aus, dass sich die Ergebnissituation in den nächsten Jahren nicht nachhaltig verbessern wird. Zwar haben der gleitende Neuwertfaktor und Prämienanpassungen für eine Steigerung der Einnahmenseite gesorgt, aber die Schadenseite steigt auch spürbar weiter an.
Welche Faktoren werden die Schadenbilanz in den kommenden Jahren am stärksten beeinflussen? Und wie gut ist die Branche aus Ihrer Sicht darauf vorbereitet?
Klimawandel, Bauregulatorik und Fachkräftemangel werden in Zukunft negativen Einfluss auf den Schadenaufwand haben. Die klimatischen Veränderungen spüren wir bereits jetzt deutlich. So ist der Elementarschadenaufwand der SV in den Jahren 2020-2024 gegenüber der Vorperiode (d.h. 2015-2019) um rund 85 Prozent gestiegen. Hier haben sich beispielsweise die Überschwemmungen im Rems-Murr-Kreis im vergangenen Jahr und die Hagelereignisse 2023 rund um Kassel ausgewirkt.
Und wir müssen leider davon ausgehen, dass der steigende Trend nicht gebrochen ist. So geht die Studie des Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) beispielsweise von einer erheblichen Zunahme der Sturm-/Hagelschäden im Sommerhalbjahr aus - bis 2040 wird von einer Zunahme um 25 Prozent ausgegangen.
Bauregulatorik ist zudem ein nicht zu unterschätzender Faktor, der Totalschäden, aber ganz besonders auch Teilschäden, verteuert. Zwei Beispiele aus der Gesetzgebung, deren Wirkung erst in der Zukunft so richtig in den Schadenbilanzen von Kunden und Versicherern ankommen werden: die Photovoltaik-Pflicht und das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Beides wird Schäden zukünftig teurer machen. Hat ein Kunde beispielsweise heute eine Ölheizung und erleidet einen Überschwemmungsschaden, so kostet die Erneuerung der Heizungsanlage aktuell etwa 25.000 EUR. Muss er nun im Zuge der Reparaturarbeiten künftig eine Pelletsheizung oder eine Wärmepumpe installieren, so werden die Kosten etwa doppelt so hoch sein. Für den gleichen Schaden verdoppelt sich der Schadenaufwand also.
Der Fachkräftemangel ist ein weiterer Faktor, der die Kosten treibt. Klar, Angebot und Nachfrage bestimmen auch hier den Preis. Aber ich möchte noch einen anderen Aspekt des Fachkräftemangels ansprechen. Kunden finden nach einem Schadenfall häufig zeitnah gar keinen Handwerker mehr. Dies kann sich indirekt natürlich negativ auf die Zufriedenheit mit dem Versicherer auswirken. Wir als SV bieten unseren Kunden daher nach einem Schadenfall Unterstützung aus unserem langjährigen Netzwerk von Handwerkern- bzw. Schadensanierern an. Mit diesen Partnern haben wir Service- und Preisstandards vereinbart, die den Kunden zugutekommen und die diese zunehmend zu schätzen wissen.
Mit 739 Millionen Euro gebuchten Bruttoprämien und einem Marktanteil von 6,24 Prozent ist die SV Gebäudeversicherung der viertgrößte Wohngebäudeversicherer Deutschlands. Welche besonderen Herausforderungen bringt diese Marktstellung mit sich? Und welchen Einfluss hat die enge Verzahnung mit den Sparkassen auf Ihre Strategie – bietet sie in einem schwierigen Marktumfeld eher Stabilität oder birgt sie eigene Risiken?
Unsere Marktposition hat Vorteile, bringt aber auch Herausforderungen mit sich. Ein Vorteil ist, dass wir als Marktführer in unserem Geschäftsgebiet eine gute Auslastung unserer Partnerfirmen im Schadenfall gewährleisten können und mit diesen effiziente Prozesse geschaffen haben. Auf der anderen Seite bedeutet ein hoher Marktanteil aber auch besondere Herausforderungen nach einem Elementarschadenereignis, wo teilweise ganze Orte betroffen sind und wir mit unserem hohen Marktanteil in kurzer Zeit Tausende von Schäden bestmöglich für die Kunden regulieren müssen. Dabei kommen wir immer wieder an den gleichen Markt-Engpässen vorbei, wie beispielsweise den nach Überschwemmungsereignissen stark nachgefragten Trocknungsgeräten.
Wir sind uns diesen Herausforderungen bewusst und haben dafür Strategien entwickelt, wie wir unsere Kunden im Fall der Fälle bestmöglich unterstützen können. Ein Element dieser Strategie ist, dass wir als SV über die PGI Sanierung GmbH gerade selbst ein Lager mit Trocknungsgeräten für unsere Kunden aufbauen.
Noch ein Wort zu den Sparkassen. Die Sparkassen haben für uns ja zwei wesentliche Rollen inne. Einmal die als Vertriebspartner und natürlich die als Eigentümer. Als Vertriebspartner profitieren wir, da die Sparkassen eine breite Kundenbasis haben und die Bedarfe der Kunden durch ihre Nähe zu diesen gut einschätzen können. In der Rolle als Eigentümer sind die Sparkassen in meinen Augen ganz klar ein Stabilitätsanker. An dieser Stelle sei nur erwähnt, dass die Sparkassen uns die Möglichkeit einer nachhaltigen Geschäftsentwicklung geben und dies, ohne überzogene Ergebnisanforderungen an uns zu stellen. Dies ist ganz besonders in diesen unruhigen Zeiten ein unschätzbarer Vorteil.
Die Bedrohung durch extreme Wetterphänomene wurde in den letzten Jahren besonders durch die Katastrophe im Ahrtal deutlich. Auch die SV Gebäudeversicherung war betroffen, wie die hohe Schaden-Kosten-Quote in diesem Jahr zeigt. Wie können sich Versicherer auf solche Extremereignisse besser vorbereiten? Und hatte dieses Ereignis konkrete Auswirkungen auf Ihre Tarifgestaltung oder Produktstrategie?
Die Katastrophe im Ahrtal hat uns vor Augen geführt, wie wichtig es ist, auf extreme Wetterereignisse vorbereitet zu sein. Um besser auf solche Ereignisse reagieren zu können, setzen wir verstärkt auf präzisere Risikomodelle, nutzen moderne Datenanalysen, optimieren unsere Rückversicherungsstrategien und bauen unser Handwerkernetzwerk weiter aus. Seit 2021 haben wir über die PGI Sanierung GmbH sogar eigene Handwerker, auf die unsere Kunden im Schadenfall zurückgreifen können.
Anzeige
Unsere Tarife prüfen wir selbstverständlich regelmäßig auf ihre Auskömmlichkeit. Die veränderten Kundenbedarfe – etwa durch zunehmende Elementarereignisse – fließen konsequent in unsere Produktstrategie ein. Mit unserem neuen PrivatSchutz, den wir im Mai einführen, bieten wir unter anderem neue Selbstbehaltsvarianten im Bereich Elementar an, um Kundinnen und Kunden mehr Einfluss auf die Prämienhöhe zu ermöglichen. Zudem sorgen klarer formulierte Bedingungen – etwa zur Definition von Überschwemmung – für mehr Transparenz.
„Eine Pflichtversicherung in Reinform würde zu kurz greifen“
Der Anpassungsfaktor für die Wohngebäudeversicherung lag 2023 auf einem historischen Höchststand von 14,7 Prozent und wurde 2024 auf 7,5 Prozent gesenkt. Sind diese Anpassungen ausreichend, um die steigenden Schadenkosten aufzufangen – oder stehen weitere Prämienerhöhungen bevor?
Der gleitende Neuwertfaktor bildet im Kern die Entwicklung der Baukosten für Neubauten ab. Dieser war in den Jahren 2023 und 2024 außergewöhnlich hoch, normalisiert sich im Moment aber wieder. Für 2025 ist der gleitende Neuwertfaktor lediglich um 2,3 Prozent gestiegen.
Anzeige
Der gleitende Neuwertfaktor bildet aber zwei Aspekte nicht ab. Der eine Aspekt ist die Teuerung bei Teilschäden – und hier spielt der Einfluss der bereits erwähnten Bauregulatorik eine erhebliche Rolle. Der zweite Aspekt sind zunehmende Schadenhäufigkeiten, insbesondere im Elementarschadenbereich. Es ist daher nicht auszuschließen, dass es weitere Prämienerhöhungen geben wird.
Welche Präventionsmaßnahmen können die Schaden-Kosten-Bilanz nachhaltig verbessern? Gibt es bereits konkrete Projekte der SV Gebäudeversicherung, um durch Prävention langfristig Kosten zu senken?
Um die Schaden-Kosten-Bilanz nachhaltig zu verbessern, sehe ich mehrere zentrale Maßnahmen. Zunächst spielt eine vorausschauende Gebäudeplanung und -konstruktion eine wichtige Rolle, etwa durch hochwasserangepasste Bauweisen oder hagelfeste Dachziegel bzw. Fassadenelemente, die Schäden von vornherein verhindern können. Für die Beurteilung, wie gefährdet das Gebäude ist, sollte immer ein Fachplaner bzw. -ingenieur hinzugezogen werden. Im Falle von Hochwasser kann dies beispielsweise über den Hochwasserpass geschehen. Mit dem Pass können sich Hausbesitzer ein Bild über ihr individuelles Risiko für Überschwemmungen, Starkregen, Rückstau oder Grundhochwasser machen. Er dient der Analyse und dem Nachweis, wie gefährdet das Gebäude ist und welche Maßnahmen zu dessen Schutz ergriffen werden können.
Darüber hinaus bieten Smart-Home-Technologien in Kombination mit Big-Data eine gute Möglichkeit der Kontrolle und Frühwarnung: Sensoren können frühzeitig Undichtigkeiten im Leitungswassernetz erkennen und es können Maßnahmen eingeleitet werden, um den Schaden gering zu halten. Wir verproben solche neuen Ansätze regelmäßig mit unseren Partnern und Dienstleistern. Unterstützend wirken auch Unwetterwarnungen bzw. der Unwetterwarnservice. Denn man kann erst dann aktiv werden, wenn man die Gefahr kennt. Also zum Beispiel vor dem Sturm die Gartenmöbel sichern. Entsprechende Unwetterwarnungen können unsere Kunden über die "SV Haus&Wetter"-App erhalten. Aber auch die App "KATWARN"unterstützt bei der Verbreitung von Warnhinweisen an die Bevölkerung.
Die Forderung nach einer Pflichtversicherung für Elementarschäden wird immer wieder diskutiert. Wie stehen Sie dazu? Und würde eine solche Lösung die Risiken in der Branche fairer verteilen – oder sehen Sie Alternativen?
Die Diskussion versteht sich ja vor dem Hintergrund, dass im Marktschnitt knapp die Hälfte der Hauseigentümer im Bereich Wohngebäude keine sogenannte Elementarschadenversicherung, die beispielsweise vor Überschwemmungsschäden schützt, abgeschlossen hat. Bei uns als SV haben übrigens bereits rund 75 Prozent der Wohngebäudekunden eine Elementarschadenversicherung und sind damit gut abgesichert. Dennoch sind auch 25 Prozent Nicht-Elementar-Versicherte ein zu hoher Wert.
Eine Pflichtversicherung in Reinform würde aber zu kurz greifen und könnte zudem Präventionsanreize nehmen. Ungeachtet dessen unterstützen wir als SV die Zielsetzung, die Versicherungsdichte im Kundeninteresse weiter zu erhöhen. Wir favorisieren eine Opt-Out-Lösung, bei welcher der Elementarschutz automatisch in Wohngebäudeversicherungen integriert ist, aber auf Kundenwunsch abgewählt werden kann. So bleibt die Wahlfreiheit der Versicherungsnehmer erhalten, während die Versicherungsdichte nach unserer Überzeugung spürbar steigen würde.
Ergänzend sind für ein tragfähiges Gesamtkonzept aber auch verstärkte Präventionsmaßnahmen erforderlich. Nur durch ein Zusammenspiel aus Versicherungsschutz, Prävention und staatlicher Unterstützung können wir nachhaltige Lösungen schaffen, die Risiken reduzieren, ohne Marktmechanismen außer Kraft zu setzen.
Welche konkreten Maßnahmen erwarten Sie von der Politik, um die Situation der Wohngebäudeversicherer zu verbessern? Sind z. B. staatlich unterstützte Rückversicherungen oder steuerliche Entlastungen denkbare Lösungen?
Ziel muss es doch sein, dass wir nachhaltig Versicherungsschutz für die Elementargefahren anbieten, der für die Gebäudeeigentümer eine kalkulierbare und verlässliche Größe ist. Dies auch dann, wenn sich die Risikosituation durch den Klimawandel weiter verschlechtern sollte. Eine staatlich unterstützte Rückversicherungslösung für Extremereignisse könnte dabei helfen und steuerliche Entlastungen könnten die steigenden Kosten für Versicherungsnehmer abmildern.
Anzeige
Entscheidend ist aber eine wirksame Präventionsstrategie. Dazu gehört eine verpflichtende Berücksichtigung von Naturgefahren in der Bauleitplanung sowie ein Baustopp in hochgefährdeten Gebieten. Darüber hinaus braucht es Anreizsysteme für private Schutzmaßnahmen, etwa hochwassersichere Bauweisen und Rückstauklappen. Die Einführung einheitlicher Gebäudestandards für Naturgefahrenschutz könnte dazu beitragen, Schäden und damit auch Versicherungskosten in Grenzen zu halten. Zudem ist eine bessere Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen notwendig, um Hochwasserschutzmaßnahmen gezielt und aufeinander abgestimmt auszubauen.
- SV SparkassenVersicherung-Vorstand: „Ohne Prävention wird bezahlbarer Schutz kaum möglich sein“
- „Eine Pflichtversicherung in Reinform würde zu kurz greifen“